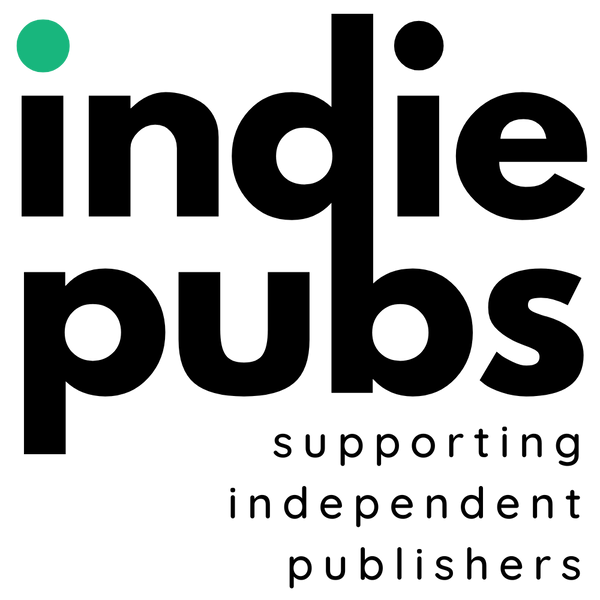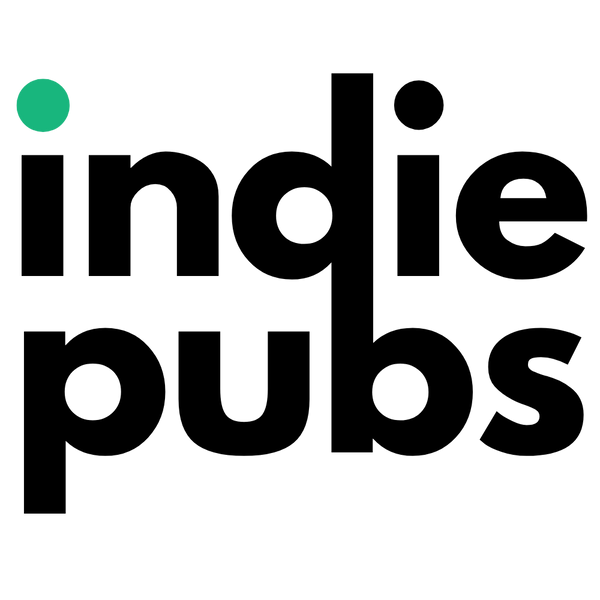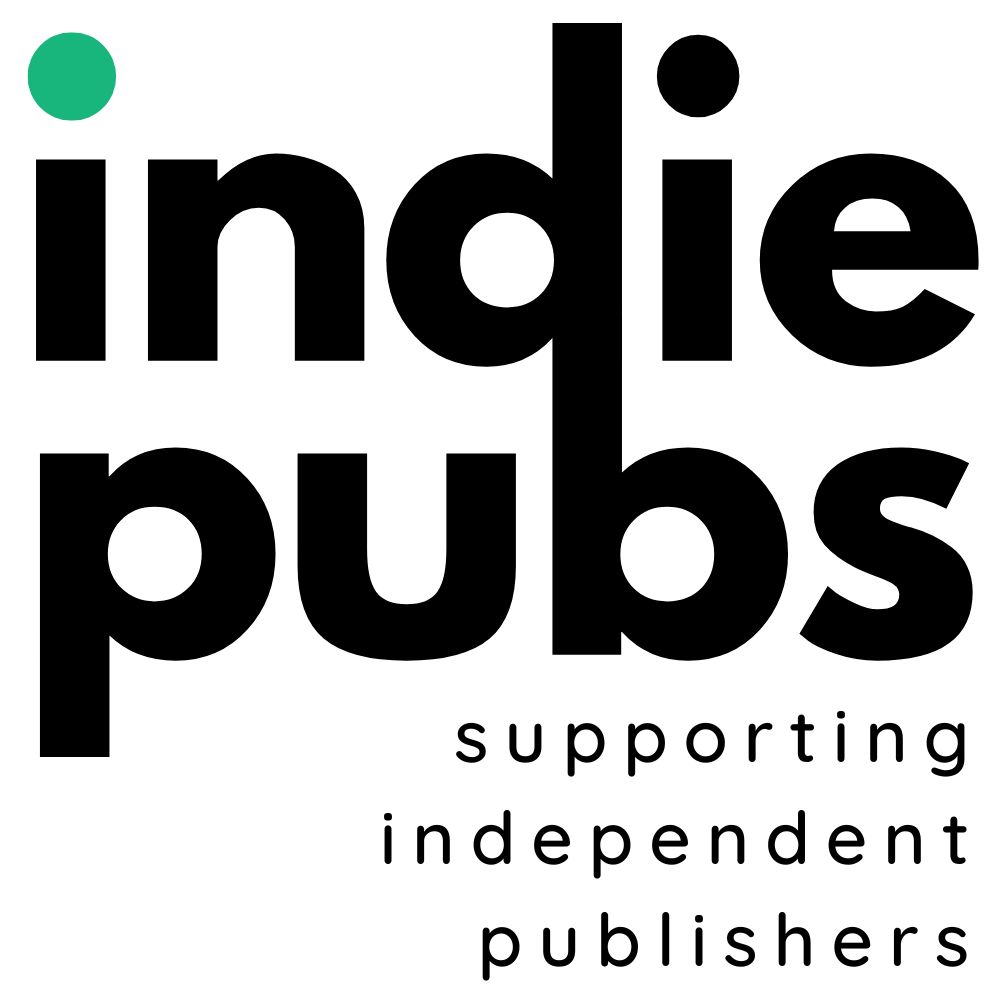We're sorry. An error has occurred
Please cancel or retry.
Die Kierkegaard-Rezeption Emanuel Hirschs
Regular price
£136.00
Sale price
£136.00
Regular price
£0.00
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Re-stocking soon
English summary: The work of the German theologian Emanuel Hirsch (1888-1972) is complex and ambiguous. Hirsch was a systematic theologian, and his research focused on the era of idealism and on Lu...
Read More
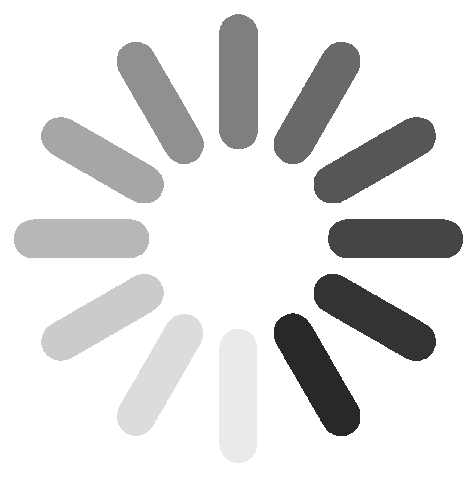
Some error occured while loading the Quick View. Please close the Quick View and try reloading the page.
Couldn't load pickup availability
- Format:
-
12 January 2006
English summary: The work of the German theologian Emanuel Hirsch (1888-1972) is complex and ambiguous. Hirsch was a systematic theologian, and his research focused on the era of idealism and on Luther, on Kierkegaard and the translation of his work. He was also a dedicated follower of the Deutsche Christen. His work on Kierkegaard continued throughout his entire life. Matthias Wilke shows how Hirsch's thinking originated in his study of the works of J.G. Fichte, K. Holl, S. Kierkegaard and the Scandinavian research on Kierkegaard from 1908 until late in his life. Hirsch studied how the truth of the Christian faith could be communicated appropriately in the context of the specific social circumstances. The author shows which of the prerequisites for the communication of the Christian truth were common to both Kierkegaard and Hirsch, and the ways in which they differed. He outlines the development of Hirsch's systematic theology and analyzes Kierkegaard's hermeneutics.
German description: Das Werk des Theologen Emanuel Hirsch (1888-1972) ist vielschichtig - und zwiespaltig: Hirsch der Systematiker, der Idealismus- und Luther-Forscher, der Kierkegaard-Forscher und Ubersetzer, aber auch: ein uberzeugter Anhanger der Deutschen Christen. Ein Kontinuum stellt die Beschaftigung mit Kierkegaard dar. Der Einfluss Kierkegaards auf die Theologie Emanuel Hirschs ist immer wieder konstatiert, bisher jedoch nur ansatzweise aufgearbeitet worden. Matthias Wilke geht der Genese von Hirschs Denken in der Auseinandersetzung mit J.G. Fichte, K. Holl, S. Kierkegaard und der skandinavischen Kierkegaard-Forschung von 1908 bis in Hirschs Spatwerk hinein nach. Hirsch zeigt besonderes Interesse an Kierkegaards (indirekter) Mitteilung christlicher Wahrheit, die ihrerseits auf der Analyse der Beziehung zwischen humanem und christlichem Wahrheitsbewusstsein basiert. Der Hauptteil des vorliegenden Buches beinhaltet die systematische Untersuchung der Doppelbewegung von Aneignung und Mitteilung der Wahrheit in den Schriften Kierkegaards sowie Hirschs Analyse und Umformung derselben zu seinem Konzept der Kommunikation christlicher Wahrheit. Der Autor weist nach, dass Hirsch die Selbstdistanz des Subjekts in seine Analyse der christlichen Existenzdialektik an entscheidenden Punkten einzieht, wahrend Kierkegaard sie durch die Letztbindung der Wahrheitskommunikation an das eigene Christusbild prinzipiell zur Geltung bringt.
German description: Das Werk des Theologen Emanuel Hirsch (1888-1972) ist vielschichtig - und zwiespaltig: Hirsch der Systematiker, der Idealismus- und Luther-Forscher, der Kierkegaard-Forscher und Ubersetzer, aber auch: ein uberzeugter Anhanger der Deutschen Christen. Ein Kontinuum stellt die Beschaftigung mit Kierkegaard dar. Der Einfluss Kierkegaards auf die Theologie Emanuel Hirschs ist immer wieder konstatiert, bisher jedoch nur ansatzweise aufgearbeitet worden. Matthias Wilke geht der Genese von Hirschs Denken in der Auseinandersetzung mit J.G. Fichte, K. Holl, S. Kierkegaard und der skandinavischen Kierkegaard-Forschung von 1908 bis in Hirschs Spatwerk hinein nach. Hirsch zeigt besonderes Interesse an Kierkegaards (indirekter) Mitteilung christlicher Wahrheit, die ihrerseits auf der Analyse der Beziehung zwischen humanem und christlichem Wahrheitsbewusstsein basiert. Der Hauptteil des vorliegenden Buches beinhaltet die systematische Untersuchung der Doppelbewegung von Aneignung und Mitteilung der Wahrheit in den Schriften Kierkegaards sowie Hirschs Analyse und Umformung derselben zu seinem Konzept der Kommunikation christlicher Wahrheit. Der Autor weist nach, dass Hirsch die Selbstdistanz des Subjekts in seine Analyse der christlichen Existenzdialektik an entscheidenden Punkten einzieht, wahrend Kierkegaard sie durch die Letztbindung der Wahrheitskommunikation an das eigene Christusbild prinzipiell zur Geltung bringt.

Price: £136.00
Pages: 568
Publisher: Mohr Siebeck
Imprint: Mohr Siebeck
Series: Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie
Publication Date:
12 January 2006
ISBN: 9783161487774
Format: Hardcover
BISACs:
PHILOSOPHY / Religious, RELIGION / Philosophy, Philosophy of religion

Siglenverzeichnis A Einleitung
I. Das Thema
II. Die Charaktere: Soren Kierkegaard und Emanuel Hirsch
1. Die biographische Pradisposition ihrer Kommunikationskonzepte
2. Das Zwiegesprach Hirschs mit Kierkegaard in der Forschungsliteratur
III. Der biographisch-systematische Aufbau der Studie
B Erstes Kapitel: Begegnung - 1908
I. Die Kierkegaard-Rezeption zur Zeit des deutschen Kaiserreichs
II. Hirschs Weg zum jungen nationalen Luthertum
III. Karl Holl und die Existenzdialektik Kierkegaards
1. Der Fall Schrempf
2. Rechtfertigungslehre im Angesicht der Moderne
3. Soren Kierkegaard in der Sicht Karl Holls
IV. Die Weiterfuhrung der Kierkegaard-Rezeption Holls durch Emanuel Hirsch
C Zweites Kapitel: Hirschs theologische Interessen: 1913-1927
I. Kierkegaard und die Renaissance-Bewegungen zu Beginn der Weimarer Republik
II. Hirschs Weg von der idealistischen Geschichtsphilosophie zu Kierkegaard
III. Hirsch als Geschichtsinterpret
1. Die Bindung der Mitteilung an die gegenwartige geschichtliche Lage
2. Die individuelle Erscheinung des Wesentlichen
3. Erste Uberlegungen zu Reflexion und Kommunikation
4. Das Konzept einer theistischen Geschichtsphilosophie
5. Tatsachenerhebung und Sinndeutung
IV. Hirschs Studien der 20er Jahre zu J.G. Fichte und zur Fruhromantik
1. Die zugrundeliegende Romantik- und Kunstauffassung
2. Novalis und G.W.F. Hegel
3. Die Vertiefung der Fichtekritik
4. Hirschs erster Ansatz in existentieller Geschichtsphilosophie
V. Die Frage nach der Christologie Kierkegaards - Ein Blick auf Hirschs Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann
1. Mitteilung von Innerlichkeit und wissenschaftliche Christologie
2. Die Stellung zum Paradox
3. Das Inkognito und die Ostererfahrung
4. Hirschs Fassung des Gleichzeitigkeitsverstandnisses
VI. Hirschs Kierkegaard-Bild (1920-1927)
D Drittes Kapitel: Hirschs personlicher und wissenschaftlicher Zugang zu Leben und Werk Kierkegaards: 1922-1933
I. Die Briefe Hirschs an Geismar
1. Die Pragung des Dialogs durch das jeweilige Vorverstandnis
2. Der Dialogcharakter des Briefwechsels (1922-1931)
II. Hirschs neu erwachtes Interesse an Kierkegaard
III. Der Aufbau des geschichtsmethodologischen Rahmens der Kierkegaard-Studien im Dialog mit der skandinavischen Forschung
1. Hirschs Weg zur systematisch-psychologischen Rekonstruktion der Werke Kierkegaards
2. Die Mitteilungsstrukturen und der Aufbau der Kierkegaard-Studien
3. Hirschs Umgang mit den Quellen in Abgrenzung zu Heibergs Psychologischer Mikroskopie
IV. Hirschs Kierkegaard-Bild (1928-1930)
E Viertes Kapitel: Das Gesprach uber die Voraussetzungen der Kommunikation christlicher Wahrheit
I. Das Verhaltnis Kierkegaards zur Philosophie J.G. Fichtes in der Forschungsliteratur
II. Grundzuge der Philosophie J.G. Fichtes - aufgezeigt anhand der Bestimmung des Menschen von 1800
1. Im Banne des Dogmatismus
2. Die Aporie des reinen Idealismus
3. Das Gewissen und die Wahrheit des Wissens
III. Hirschs Analyse der philosophisch-theologischen Studien des jungen Kierkegaard
1. Kierkegaards Jugenddenken im Verhaltnis zu J.G. Fichte und zur Romantik
2. Kierkegaards Jugenddenken im Verhaltnis zu I.H. Fichte und K. Daub
3. Kierkegaards Der Begriff Ironie (1841)
4. Kierkegaards Eine literarische Anzeige (1846)
IV. Das ethisch-religiose Gewissen und die Gemeinschaft
1. Hirschs Aufnahme des Gewissensbegriffs J.G. Fichtes
2. Kierkegaards erste Anthropologie
3. Hirschs Analyse der ersten Anthropologie Kierkegaards
4. Hirschs Umformung der anthropologischen Pramissen Kierkegaards
V. Das christliche Selbstverstandnis und die Verstandigung des Christen
1. Hiatus und Liebe bei Hirsch und Kierkegaard
2. Kierkegaards zweite Anthropologie
3. Hirschs Analyse der zweiten Anthropologie Kierkegaards
F Funftes Kapitel: Emanuel Hirsch als Deuter und Gestalter ethisch-religioser Charaktere
I. Das Kierkegaard-Bild Hirschs in seiner Vollendung
1. Das Bild vom Dichter Kierkegaard
2. Kierkegaard als ethisch-religioses Vorbild
II. Hirschs Bild vom wahren Dichter
III. Geismars Kritik an Hirschs politisch-theologischer Kierkegaard-Rezeption
IV. Hirschs novellistische Existenzanalysen
G Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
I. Das Thema
II. Die Charaktere: Soren Kierkegaard und Emanuel Hirsch
1. Die biographische Pradisposition ihrer Kommunikationskonzepte
2. Das Zwiegesprach Hirschs mit Kierkegaard in der Forschungsliteratur
III. Der biographisch-systematische Aufbau der Studie
B Erstes Kapitel: Begegnung - 1908
I. Die Kierkegaard-Rezeption zur Zeit des deutschen Kaiserreichs
II. Hirschs Weg zum jungen nationalen Luthertum
III. Karl Holl und die Existenzdialektik Kierkegaards
1. Der Fall Schrempf
2. Rechtfertigungslehre im Angesicht der Moderne
3. Soren Kierkegaard in der Sicht Karl Holls
IV. Die Weiterfuhrung der Kierkegaard-Rezeption Holls durch Emanuel Hirsch
C Zweites Kapitel: Hirschs theologische Interessen: 1913-1927
I. Kierkegaard und die Renaissance-Bewegungen zu Beginn der Weimarer Republik
II. Hirschs Weg von der idealistischen Geschichtsphilosophie zu Kierkegaard
III. Hirsch als Geschichtsinterpret
1. Die Bindung der Mitteilung an die gegenwartige geschichtliche Lage
2. Die individuelle Erscheinung des Wesentlichen
3. Erste Uberlegungen zu Reflexion und Kommunikation
4. Das Konzept einer theistischen Geschichtsphilosophie
5. Tatsachenerhebung und Sinndeutung
IV. Hirschs Studien der 20er Jahre zu J.G. Fichte und zur Fruhromantik
1. Die zugrundeliegende Romantik- und Kunstauffassung
2. Novalis und G.W.F. Hegel
3. Die Vertiefung der Fichtekritik
4. Hirschs erster Ansatz in existentieller Geschichtsphilosophie
V. Die Frage nach der Christologie Kierkegaards - Ein Blick auf Hirschs Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann
1. Mitteilung von Innerlichkeit und wissenschaftliche Christologie
2. Die Stellung zum Paradox
3. Das Inkognito und die Ostererfahrung
4. Hirschs Fassung des Gleichzeitigkeitsverstandnisses
VI. Hirschs Kierkegaard-Bild (1920-1927)
D Drittes Kapitel: Hirschs personlicher und wissenschaftlicher Zugang zu Leben und Werk Kierkegaards: 1922-1933
I. Die Briefe Hirschs an Geismar
1. Die Pragung des Dialogs durch das jeweilige Vorverstandnis
2. Der Dialogcharakter des Briefwechsels (1922-1931)
II. Hirschs neu erwachtes Interesse an Kierkegaard
III. Der Aufbau des geschichtsmethodologischen Rahmens der Kierkegaard-Studien im Dialog mit der skandinavischen Forschung
1. Hirschs Weg zur systematisch-psychologischen Rekonstruktion der Werke Kierkegaards
2. Die Mitteilungsstrukturen und der Aufbau der Kierkegaard-Studien
3. Hirschs Umgang mit den Quellen in Abgrenzung zu Heibergs Psychologischer Mikroskopie
IV. Hirschs Kierkegaard-Bild (1928-1930)
E Viertes Kapitel: Das Gesprach uber die Voraussetzungen der Kommunikation christlicher Wahrheit
I. Das Verhaltnis Kierkegaards zur Philosophie J.G. Fichtes in der Forschungsliteratur
II. Grundzuge der Philosophie J.G. Fichtes - aufgezeigt anhand der Bestimmung des Menschen von 1800
1. Im Banne des Dogmatismus
2. Die Aporie des reinen Idealismus
3. Das Gewissen und die Wahrheit des Wissens
III. Hirschs Analyse der philosophisch-theologischen Studien des jungen Kierkegaard
1. Kierkegaards Jugenddenken im Verhaltnis zu J.G. Fichte und zur Romantik
2. Kierkegaards Jugenddenken im Verhaltnis zu I.H. Fichte und K. Daub
3. Kierkegaards Der Begriff Ironie (1841)
4. Kierkegaards Eine literarische Anzeige (1846)
IV. Das ethisch-religiose Gewissen und die Gemeinschaft
1. Hirschs Aufnahme des Gewissensbegriffs J.G. Fichtes
2. Kierkegaards erste Anthropologie
3. Hirschs Analyse der ersten Anthropologie Kierkegaards
4. Hirschs Umformung der anthropologischen Pramissen Kierkegaards
V. Das christliche Selbstverstandnis und die Verstandigung des Christen
1. Hiatus und Liebe bei Hirsch und Kierkegaard
2. Kierkegaards zweite Anthropologie
3. Hirschs Analyse der zweiten Anthropologie Kierkegaards
F Funftes Kapitel: Emanuel Hirsch als Deuter und Gestalter ethisch-religioser Charaktere
I. Das Kierkegaard-Bild Hirschs in seiner Vollendung
1. Das Bild vom Dichter Kierkegaard
2. Kierkegaard als ethisch-religioses Vorbild
II. Hirschs Bild vom wahren Dichter
III. Geismars Kritik an Hirschs politisch-theologischer Kierkegaard-Rezeption
IV. Hirschs novellistische Existenzanalysen
G Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis